
Sicherheitsanalyse
Kommunale Prävention sollte auf die Bearbeitung und Lösung der konkreten Problemstellungen vor Ort gerichtet sein. Was zunächst selbstverständlich klingt, ist in der Praxis nicht immer der Fall. Nicht selten orientiert sich die Auswahl von Themen und Maßnahmen stattdessen an dem, was in der öffentlichen Diskussion aktuell dramatisiert wird oder wofür gerade Fördermittel zur Verfügung stehen. Auch kommt es vor, dass sich Akteure im Rahmen der eigenen Problemlösungskompetenzen engagieren, ohne den tatsächlichen Handlungsbedarf zu berücksichtigen.
Daher ist es von großer Bedeutung zu Beginn der Arbeit eines Präventionsgremiums eine konkrete Situationsbestimmung vorzunehmen. Im Sinne eines bedarfsgerechten Vorgehens setzt der Grundgedanke der Prävention, an den Ursachen von Kriminalität ansetzen zu wollen, eine lokal spezifische Situationsanalyse voraus. Diese bildet einen zentralen und verbindlichen Arbeitsschritt für kommunale Präventionsgremien. Ziel der Situationsanalyse ist es, konkrete Probleme und Bedarfe vor Ort zu ermitteln und diesen die vorhandenen Ressourcen gegenüberzustellen. Die Situationsanalyse setzt sich demzufolge aus einer Problem- und einer Ressourcenanalyse zusammen. Aus einem Abgleich dieser beiden Analyseergebnisse lassen sich Handlungserfordernisse und Maßnahmen zielgerichtet ableiten.
Vorgehensweise
In einem ersten Schritt sollten vorhandene Probleme und Bedarfe zunächst ermittelt und hinsichtlich ihrer Relevanz gemeinsam bewertet werden. Solche Problemanalysen können unterschiedlich umfangreich und komplex ausfallen. Entsprechend der zentralen Zielsetzungen der kommunalen Kriminalprävention, die objektive Sicherheit sowie das subjektive Sicherheitsempfinden in der Gemeinde zu verbessern, sollten Problemanalysen grundsätzlich die folgenden vier Aspekte in den Blick nehmen:
- Art und Stellenwert von Problemen in der Kommune,
- die deliktspezifische Häufigkeit von Straftaten und das Anzeigeverhalten,
- verschiedene Dimensionen der Kriminalitätsfurcht,
- sowie Vorschläge zur lokalen Kriminalprävention.
Insbesondere Informationen zum subjektiven Sicherheitsgefühl bzw. zur Kriminalitätsfurcht in der Bevölkerung liegen in den seltensten Fällen bereits vor. Um diese Aspekte im Rahmen einer Problemanalyse ermitteln zu können, ist daher in aller Regel eine Befragung der Bürgerinnen und Bürger erforderlich. Je nach Erkenntnisinteresse kann bei deren Durchführung auf vorhandene, bewährte Instrumente und Good-Practice-Beispiele zurückgegriffen werden. Ein bewährtes Instrument für die Durchführung von Sicherheitsanalysen wurde bereits im Jahr 2000 von der Forschungsgruppe Kommunale Kriminalprävention Baden-Württemberg entwickelt und seit dem fortentwickelt. Den Fragebogen am Beispiel der Stadt Pforzheim finden Sie hier (Seite 81-93).
Die Verwendung eines solchen Instruments bei der Durchführung von Bedarfsanalysen ist unter verschiedenen Gesichtspunkten zu empfehlen. Die darin enthaltenen Fragen haben sich in der Praxis bereits bewährt, d.h. sie messen tatsächlich das, was gemessen werden soll. Eine methodisch aufwendige Entwicklung und Testung eigener Fragen erübrigt sich damit, wodurch viele Ressourcen geschont werden können. Zudem liegen zu diesem Instrument verhältnismäßig viele Referenzwerte vor. Dies erleichtert die Ergebnisinterpretation insofern erheblich, als die eigenen Ergebnisse mit entsprechenden Ergebnissen anderer Kommunen in ein Verhältnis gesetzt werden können. Anderenfalls stellt sich bei der Ergebnisinterpretation grundsätzlich die Frage, ab welchem Wert ein bestimmtes Ergebnis als hoch, durchschnittlich oder niedrig zu bewerten ist.
Idealerweise werden die Ergebnisse der Bedarfsanalyse im Rahmen einer sogenannten Kriminologischen Regionalanalyse (KRA) ergänzt, um Informationen aus weiteren kommunalen Informationsquellen, wie der Gesundheits-, Arbeits- oder Sozialberichterstattung.
Für die Durchführung einer Bedarfsanalyse sind einige Entscheidungen zu fällen. Dazu zählen etwa die Fragen in welcher Form die Erhebung durchgeführt werden soll (persönlich, telefonisch, schriftlich oder online-basiert), ob die gesamte Bevölkerung oder eine repräsentative Auswahl befragt werden soll oder auf welche Expertise bei der Planung, Durchführung und Auswertung der Erhebung zurückgegriffen werden kann.
Den ermittelten Problemen und Bedarfen werden in einem weiteren Schritt die in der Kommune bereits vorhandenen Ressourcen gegenübergestellt. Dies können diverse Angebote der sozialen Arbeit, Nachbarschaftsprogramme, vorhandene Präventionsangebote (beispielsweise in Schulen) oder Maßnahmen der vor Ort tätigen sozialen Träger sein. Aus einem Abgleich der Bedarfs- und der Ressourcenanalyse können Angebotslücken, Präventionsbedarfe sowie zielgerichtete Angebote und Maßnahmen abgeleitet werden.
Kommunale Sicherheitsanalysen können dazu beitragen, die Konzeption und Planung von Präventionsmaßnahmen vor Ort auf eine bessere Wissensbasis zu stellen und damit zielgerichteter und problemorientierter zu gestalten. Allerdings gibt es noch wenig Erkenntnisse darüber, wie Sicherheitsanalysen für alle Seiten gewinnbringend umgesetzt werden können. Dieser Fragestellung folgte das vom Deutschen Forum für Kriminalprävention (DFK) initiierte und vom Bundesministerium der Justiz geförderte Projekt „Transfer von empirischen Erkenntnissen zur lokalen Sicherheitslage in kommunale Präventionsstrategien“ (SiATransfer), dessen Hintergrund und zentrale Erkenntnisse mit besonderem Fokus auf Gelingensbedingungen im Abschlussbericht skizziert werden.
Tagung „Herausforderungen, Gelingensbedingungen und innovative Ansätze lokaler Sicherheitsanalysen“
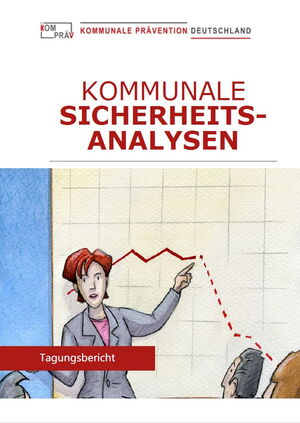
Im Rahmen einer Tagung der Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention (DFK) am 9. und 10. November 2022 erörterten Fachleute aus Wissenschaft und Präventionspraxis
Herausforderungen, Gelingensbedingungen und innovative Ansätze lokaler Sicherheitsanalysen.
Ziel der Veranstaltung war es daher mit Expertinnen und Experten der Landespräventionsgremien
und aus der Wissenschaft zu erörtern,
- welche empirischen Erkenntnisse zur Durchführung lokaler Sicherheitsanalysen
es deutschlandweit gibt, - welche Erfahrungen auf kommunaler und landesweiter Ebene mit deren Durchführung gemacht wurden,
- welche Probleme und Herausforderungen mit deren Planung, Konzeption, Umsetzung, Auswertung und Ergebnisverwertung verbunden sind und wie innovative Konzepte für Sicherheitsanalysen aussehen.
Den Tagungsbericht finden Sie hier.
Weiterführende Literatur:
Wilhelm, Jan Lorenz, Mohring, Katharina & Kober, Marcus (2023): Analysen sprechen nicht für sich!
Ergebnisse des Projekts „Transfer von empirischen Erkenntnissen zur lokalen Sicherheitslage in kommunale Präventionsstrategien“ (SiATransfer). In Kriminalprävention 1/2023.
KKP BW (2020): Planung und Durchführung von Sicherheitsbefragungen.
Eine Handreichung für Akteurinnen und Akteure der Kommunalen Kriminalprävention.

Unser Podcast zum Thema
Ein Podcast, der auf der Grundlage ausgewählter Fachtexte zur kommunalen Prävention
entstanden ist und in knapper Form in das Thema einführt.
Hier finden Sie die Episode
- Sicherheitsanalyse >